Gemeinkosten und strategische Spielräume im Preisrecht. Selten waren diese Themen so relevant wie heute. Am Vorabend des Anwendertreffens Preisrecht in Bremen haben wir mit Dr. Sara Kranemann gesprochen, die ihre Dissertation dem Thema Gemeinkostenmanagement und Kostenberechnung im Preisrecht gewidmet hat.
Transkript
tba.
Wer ist Sara Kranemann?
Sara Kranemann promovierte im Bereich Gemeinkostenmanagement und Kostenrechnung mit besonderem Blick auf das öffentliche Preisrecht. In ihrer Forschung verbindet sie klassische Controlling-Themen mit den besonderen Anforderungen der Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP). Ihre Arbeit beleuchtet damit einen Bereich, der in der Praxis oft als „unsexy“ gilt, aber von entscheidender Bedeutung für öffentliche Aufträge und die Preisprüfung ist. Ihre Dissertation wurde im Juli 2025 veröffentlicht.
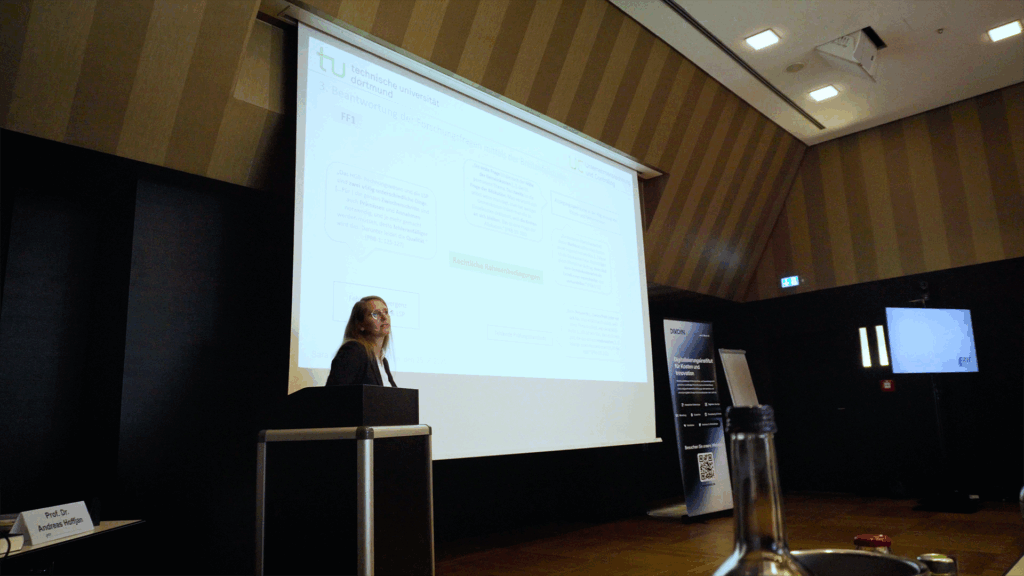
Gemeinkosten neu gedacht
Frau Dr. Kranemann hebt hervor, dass Gemeinkosten in der wissenschaftlichen Diskussion lange Zeit vernachlässigt wurden, da man seit den 1990er-Jahren stark auf Prozesskostenrechnung und Activity Based Costing fokussiert war. Heute gewinnen sie jedoch wieder an Bedeutung, insbesondere durch Themen wie Prozessmining oder prozessorientierte Budgetierung.
Ein zentrales Ergebnis ihrer Forschung: Es gibt erhebliche Spielräume bei der Abgrenzung von Gemein- und Einzelkosten. Unternehmen nutzen diese strategisch, indem sie möglichst viele Kosten den Einzelkosten zuordnen, um so ihren kalkulatorischen Handlungsspielraum zu erweitern.
Kernergebnisse ihrer Forschung
- Spielräume nutzen: Die LSP sind offener gestaltet, als viele annehmen. Das erlaubt Unternehmen, Kosten strategisch zuzuordnen, solange sie im gesetzlichen Rahmen bleiben.
- Hoher Anteil öffentlicher Aufträge = bessere Kostenrechnung: Unternehmen mit großem Anteil öffentlicher Aufträge entwickeln besonders präzise Kostenrechnungen, da sie eng an den LSP arbeiten müssen.
- Vorteile für die Privatwirtschaft: Private Geschäftsbereiche profitieren von der Genauigkeit, die durch das öffentliche Preisrecht in der Kalkulation entsteht.
- Unterschiede nach Unternehmensart: Produktionsunternehmen arbeiten mit langen, physischen Wertschöpfungsketten, während Dienstleister eher breite, stundensatzbasierte Kalkulationsschemata einsetzen.
Empfehlungen für die Praxis
Frau Dr. Kranemann gibt Unternehmen klare Hinweise, wie sie mit Gemeinkosten umgehen sollten:
- Gemeinkosten reduzieren: Gemeinkosten kritisch zu hinterfragen ist unerlässlich, um unnötige Kostenblöcke zu vermeiden.
- Klare Abgrenzung schaffen: Überschneidungsfreie Erfassung ist wichtig, um Doppelerfassungen zu verhindern.
- Primärdaten verbessern: Eine gute Datenbasis ist die Grundlage jeder sauberen Kostenrechnung. IT-Systeme ohne Medienbrüche sind entscheidend.
- Kenntnis der LSP: Nur wer die Leitsätze und ihre Freiräume kennt, kann diese auch strategisch nutzen.
- Dialog mit Preisprüfern: Proaktiver Austausch hilft, Unsicherheiten zu klären und gemeinsame Lösungen zu finden.
Besonders überrascht hat Kranemann, dass es im Preisrecht nicht primär um die Reduktion von Gemeinkosten geht. Stattdessen liegt der Fokus oft auf der Frage, wie Gemeinkosten sauber verrechnet werden können. Ebenso betont sie, dass die LSP deutlich mehr Freiheitsgrade eröffnen, als viele Praktiker erwarten.
Gemeinkosten sind kein Nebenthema. Im Preisrecht sind sie ein strategisches Steuerungsinstrument, das Unternehmen sowohl Chancen als auch Herausforderungen bietet. Wer die LSP kennt und Daten konsequent nutzt, verschafft sich Wettbewerbsvorteile.
Das nächste Anwendertreffen Preisrecht 2026 bringt Praxis, Wissenschaft und Verwaltung zum Austausch über aktuelle Entwicklungen zusammen. Die Veranstaltung bietet Fachvorträge, Diskussionsrunden und die Möglichkeit zum Networking mit führenden Expertinnen und Experten. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier:




